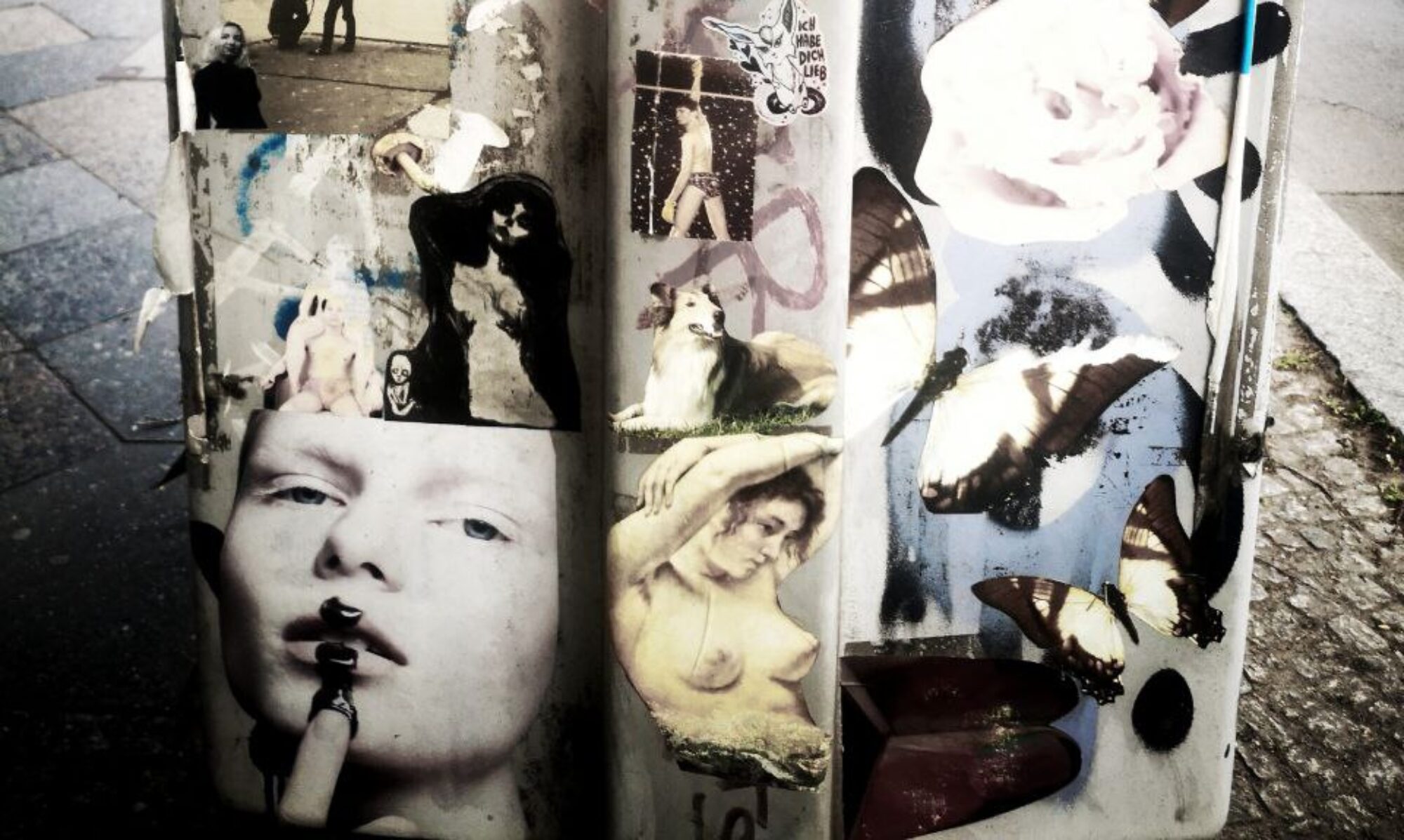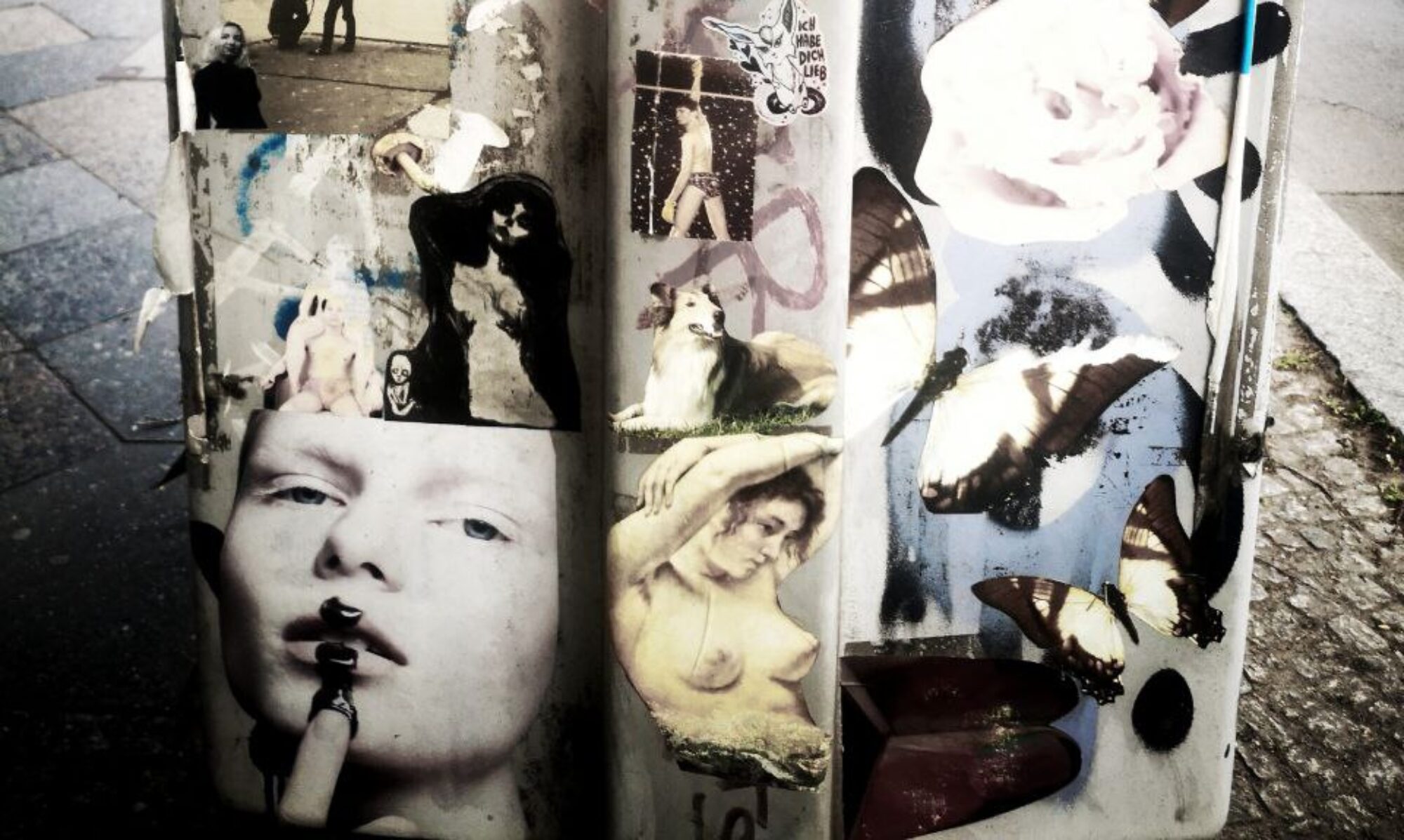Die 70er und 80er Jahre in der DDR stellten für queere Menschen eine große Herausforderung dar. Da von staatlicher Seite eine Ungleichbehandlung oder gar Diskriminierung queerer Personen zumeist kategorisch verneint wurde, obwohl sie bittere Realität war, gestaltete sich der Aufbau eigener Strukturen, die sowohl einen sicheren Raum nach innen sowie eine politische Repräsentation nach außen bieten konnten als äußerst schwierig. Anträge auf die Zugeständnisse eigener Räume, im engen wie im weiten Sinne, wurden mit Verweis auf die gesellschaftliche Gleichberechtigung abgelehnt. Wo sich dennoch Strukturen bilden konnten, geschah dies nur unter großem Aufwand und durch teils überraschende Strategien. Aufgrund des vergleichsweise liberalen politischen Klimas in Berlin hatte man hier die meisten Aussichten auf Erfolg, weshalb Berlin innerhalb der DDR zum zentralen Bezugspunkt für queere Menschen wurde. Aber auch in größeren Städten wie Leipzig oder Dresden konnten man Räume für sich schaffen.
Die folgenden Ergebnisse unserer Forschung versuchen, die queeren Strukturen und Räume der 70er Jahre bis zur Wendezeit im Osten Berlins aufzuzeigen und zu analysieren. Ein spezieller Fokus liegt dabei darauf, wie und ob Identitäten, die in der Geschichtsschreibung oft ausgeblendet werden, in den Gruppen und Strukturen der damaligen Zeit einen Platz fanden. Dabei sollten einerseits die lesbischen Perspektiven beleuchtet werden, die in der Geschichtsschreibung sowie in den Bewegungen selbst oft hinter den schwulen zurücktreten müssen. Andererseits wollten wir aber auch die Frage stellen, wo und ob auch transgeschlechtliche Menschen in solche Strukturen integriert wurden. Insbesondere, aber nicht nur, was trans Menschen angeht, sind wir dabei oft an die Grenzen dessen gestoßen, was sich rückblickend nachvollziehen lässt. Wo wir aber fündig geworden sind, haben wir versucht, diese Leerstellen zu beleuchten.
Methodisch haben wir uns dabei, ausgehend von einer ausführlichen Aneignung der Sekundärliteratur, in erster Linie intensiv mit den entsprechenden Archivbeständen beschäftigt. Dabei konnten wir auf den Bestand des Spinnbodens und vor allem die große Sammlung des Schwulen Museums zurückgreifen. Durch diese Forschung am Originalmaterial konnten wir einige Lücken füllen, die in der teils sehr überschaubaren Literatur zu dem Themenfeld offengeblieben waren.
Gleichzeitig haben wir uns mit der Tatsache konfrontiert gesehen, dass die Arbeit mit Archivalien nicht alle Perspektiven und Facetten der Vergangenheit abdecken kann. Im Versuch, die Vergangenheit auf diese Weise aufzuarbeiten, sieht man sich mit allerlei Grauzonen, Ambivalenzen und Blindstellen konfrontiert, denen es mit Vorsicht und Sensibilität gerecht zu werden gilt. Der Filter der Akten und Dokumente macht gelebte Realitäten unsichtbar, die auf dem Papier keinen Platz gefunden haben. Allzu klare Interpretationen und Urteile über konkrete Sachlagen müssen also teilweise ausbleiben. Stattdessen kann das Präsentierte als ein Gerüst verstanden werden, um das herum gebaut werden kann, um die zwangsläufigen Zwischenräume zu ergänzen.