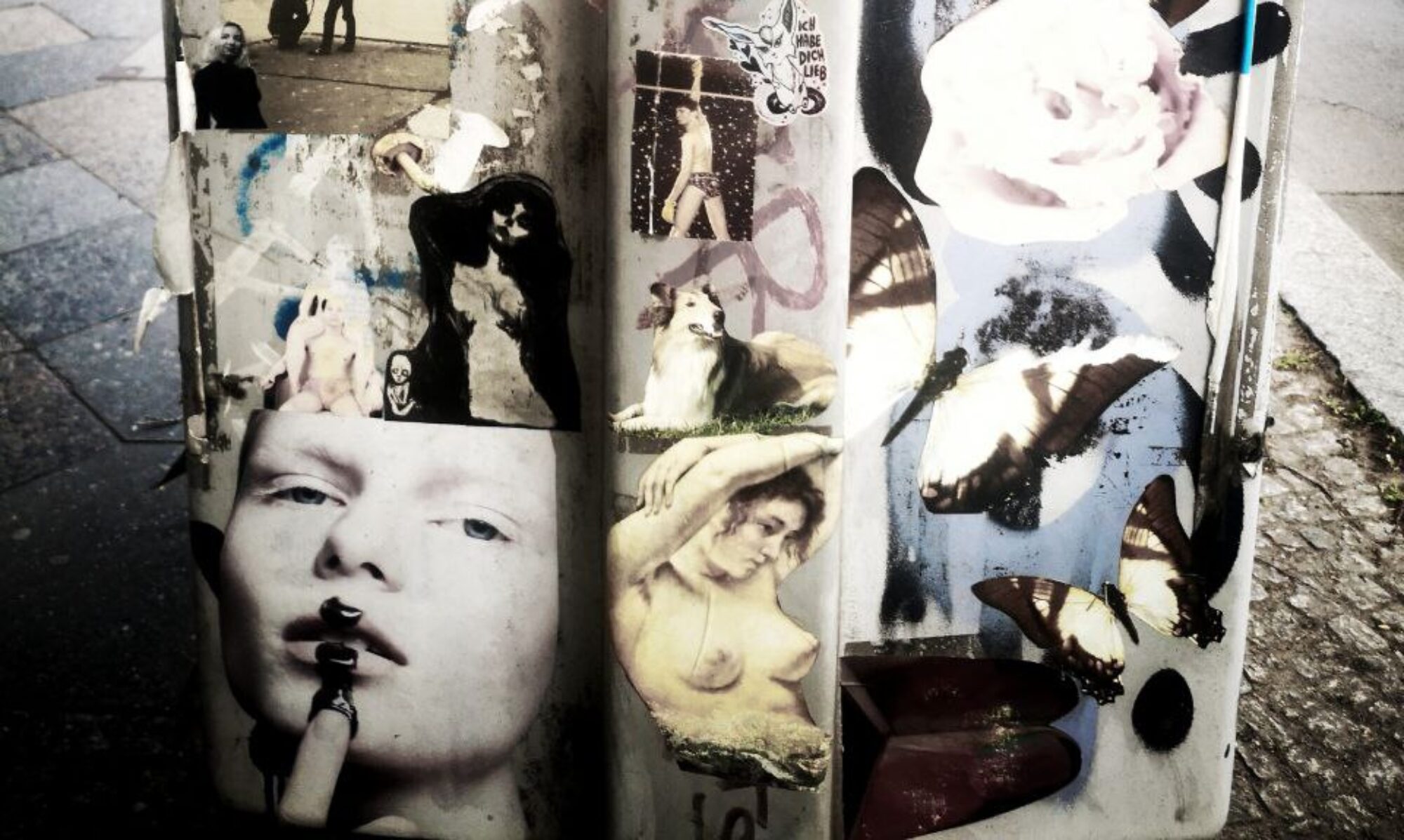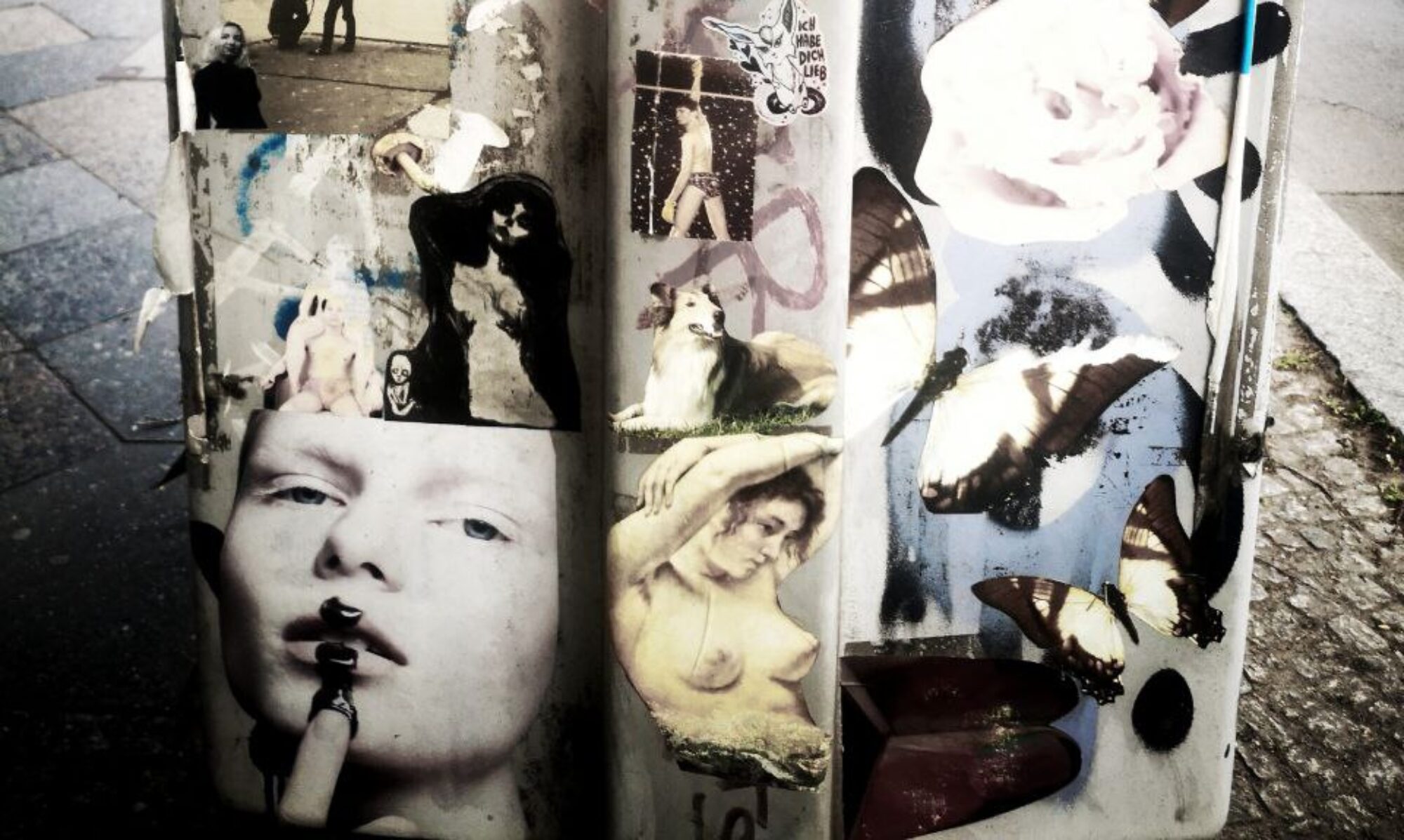Außerhalb des kirchlichen Schutzraumes sah man sich einer Reihe von Hürden gegenüber. An erster Stelle stand das Problem der Räumlichkeiten, denn in einer Gesellschaft, in der die Gleichberechtigung von staatlicher Seite als umgesetzt proklamiert wurde, gab es keine Notwendigkeit für die Öffnung eigener Räume für vermeintlich marginalisierte Gruppen. Da sich unter diesen Umständen die Gewinnung staatlich bereitgestellter Lokalitäten oft als schwierig, wenn auch nicht immer unmöglich darstellte, mussten Alternativen gefunden werden.
Eine Möglichkeit bestand in der Nutzung privater und halbprivater Räume. Partys in der Wohnung Christiane Seefelds in der Schönhauser Allee, Gruppentreffen der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlin (HiB) im Gründerzeitmuseum von Charlotte von Mahlsdorf oder semi-öffentliche Treffpunkte in Bars, Cafés und Diskotheken sind Beispiele für die diversen Formen solcher Strategien. Dass jedoch auch die Gewinnung offizieller Räumlichkeiten möglich war, zeigt der Sonntags-Club (SC). Als inoffizieller Verein konnte er Ende der 80er im Kreiskulturhaus im Prenzlauer Berg Einzug halten. Auf das Zugeständnis selbstverwalteter Räume musste man aber auch hier noch bis zur Wendezeit warten.
Das Feld an Räumen und deren Funktionen, das sich hier auftut, ist äußert heterogen. Das Spektrum spannt sich zwischen politischem Aktivismus auf der einen und Freizeitgestaltung auf der anderen Seite. Verallgemeinernde Beschreibungen, ob als staatsnah, oppositionell, apolitisch, inklusiv, exklusiv und so weiter, müssen also zurückgewiesen werden. Vielmehr bedarf es eingehender Einzelbetrachtungen.
Literatur :
Grau, Günter: Sozialistische Moral und Homosexualität. Die Politik der SED und das Homosexuellenstrafrecht 1945 bis 1989 – ein Rückblick, in: Grumbach, Detlef (Hg.): Die Linke und das Laster. Schwule Emanzipation und linke Vorurteile, Hamburg 1995, S. 85-141, hier: S. 125.
Meyer, Sabine: Wege jenseits der Öffentlichkeit. Zur Geschichte transgeschlechtlichen Lebens in der SBZ und der DDR zwischen 1945 und 1976, in: Landesstelle für Gleichbehandlung − gegen Diskriminierung (Hg.): Auf nach Casablanca? Lebensrealitäten transgeschlechtlicher Menschen zwischen 1945 und 1980, S. 75-83.
Sonntags-Club (Hg.): Verzaubert in Nord-Ost. Die Geschichte der Berliner Lesben und Schwulen in Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee, Berlin 2009.