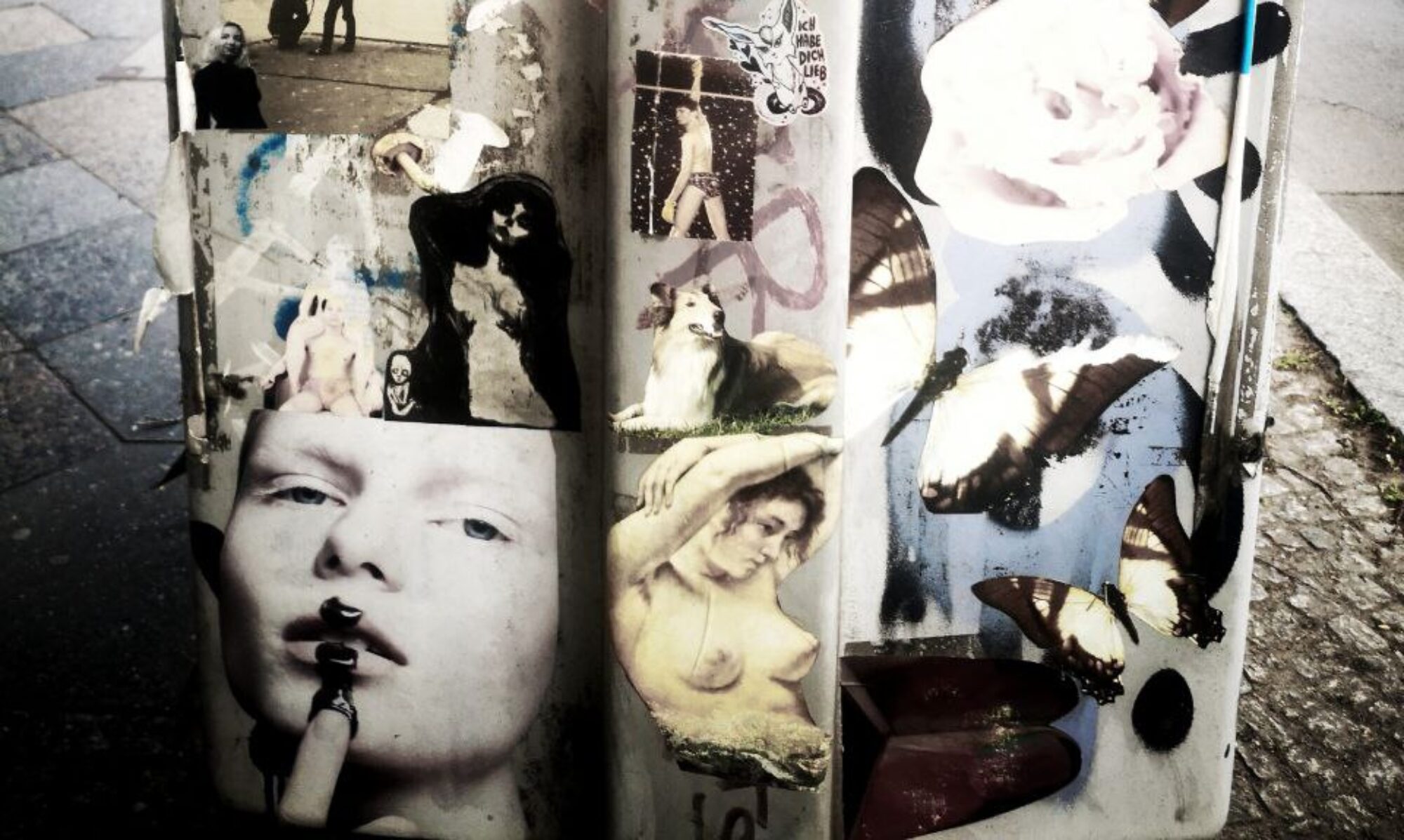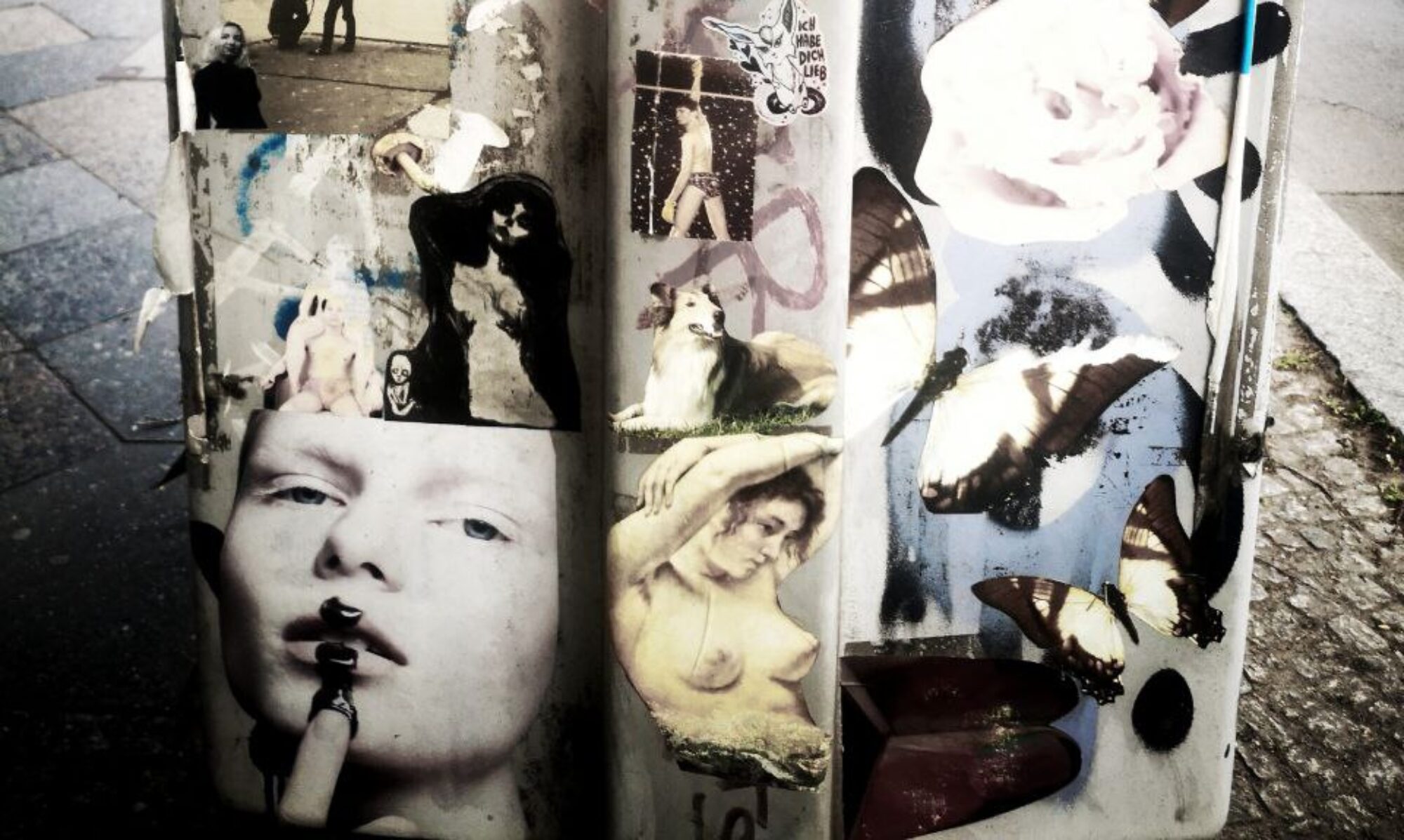Während die katholische Kirche Konflikte mit der SED-Regierung eher scheute, avancierten viele evangelische Gemeinden in der DDR zu Sammelbecken für politisch kritische oder oppositionelle Gruppierungen. Auch für die Lesben- und Schwulenbewegung der 80er Jahre spielten evangelische Gemeinden eine wichtige Rolle, war die Kirche doch die einzige Institution, die relativ unabhängig vom staatlichen Zugriff agieren konnte.
Homosexualität entsprach nicht den sozialistischen Moralvorstellungen, die auf der heteronormativen Familie als „kleinste Zelle der sozialistischen Gesellschaft“ [1] basierten. Daher wurden queere Gruppierungen aus Regierungs- und Staatssicherheitskreisen generell kritisch betrachtet. Wollte man sich aktiv kritisch äußern und die Gesellschaftsordnung infrage stellen, war die wohl sicherste Strategie, sich unter das Dach der evangelischen Kirche zu begeben und sich dort Freiräume zu schaffen, aus deren relativer Sicherheit heraus sogar eine zumindest kleine Öffentlichkeit erreicht werden konnte. So ist es nicht verwunderlich, dass sich in evangelischen Gemeinden teils recht aktivistische Arbeitskreise (AKs) zum Thema Homosexualität formierten, die sich auch selbst als oppositionell verstanden. Das führte auch dazu, dass nicht-kirchliche Gruppierungen von kirchlichen queeren Kreisen teilweise als staatsnah wahrgenommen wurden.
Dafür waren jedoch bei weitem nicht alle Gemeinden offen, was für den einen oder anderen AK erhebliche Probleme bei der Raumsuche bedeutete. Da die Kirchenleitung sich zu keiner einheitlichen Linie gegenüber homosexuellen Personen und deren AKs durchringen konnte, traf jede Gemeinde selbst die Entscheidung, ob sich ein solcher AK bei ihr ansiedeln und ihre Räumlichkeiten nutzen durfte. Dabei kam es nach Anfragen von homosexuellen Gruppierungen immer wieder zu deutlichen Ablehnungen. Aufklärerische Bestrebungen wie etwa die Studie ‚Homosexuelle in der Kirche?‘ von der theologischen Studienabteilung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR von 1984 oder der Zeitungsartikel ‚Homosexuelle in der Kirche‘ [2], der am 06. März 1983 in Die Kirche erschien, argumentierten zwar für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Vereinbarkeit von Christentum und Homosexualität, machen dadurch aber auch klar, dass genau dies in den kirchlichen Kreisen noch lange nicht realisiert war. Insbesondere in dem genannten Zeitungsartikel wird die Abwehrhaltung einiger Christ:innen deutlich: Hier wird aus homophoben Leser:innenbriefen zitiert, die Meinungen darüber kundtun, ob homosexuelle Menschen einen Platz in der evangelischen Kirche haben sollten. So heißt es etwa erbost:
„Dieser Artikel ist ein Plädoyer für die Homosexuellen! Und damit für eine Sünde, die Gott ein ‚Greuel‘ ist … Aber das Wort ‚Sünde‘ kommt in dem Artikel überhaupt nicht vor.“
Eine andere Person schrieb:
„Homosexualität ist Perversion der Schöpfung! Nach dem Schöpfungswillen Gottes können nur Mann und Weib ‚ein Leib‘ sein, aber nicht Mann und Mann, nicht Frau und Frau.“
Trotz dieses teils heftigen Gegenwinds fanden sich Anfang der 80er Jahre einzelne Gemeinden, die den gerade erst entstehenden Gruppierungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellten und damit Schutzräume boten für verschiedenste Formate und Bestrebungen.
[1] Präambel des Familiengesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik.
[2] Schwules Museum, Berlin: Zeitungsartikel ‚Homosexuelle in der Kirche‘ (Die Kirche, 06. März 1983), Sammlung DDR Kirchliche AKs Homosexualität, Mappe Nr. 1 – Gesprächskreis Homosexualität.
Literatur:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Hg.): Homosexuelle in der Kirche? Ein Text der Theologischen Studienabteilung beim Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, Berlin 1985.
Sillge, Ursula: Damals war’s! Zu Bedingungen, Strukturen und Definitionen der lesbisch-schwulen Bewegung in der DDR, in: Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt, LSDV Sachsen-Anhalt (Hg.): Lesben und Schwule in der DDR. Tagungsdokumentation, Halle 2008, S. 109-116.
Schmidt, Kristine: Lesben und Schwule in der Kirche, in: Dobler, Jens: Verzaubert in Nord-Ost: die Geschichte der Berliner Lesben und Schwulen in Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee, Berlin 2009, S. 198-220.