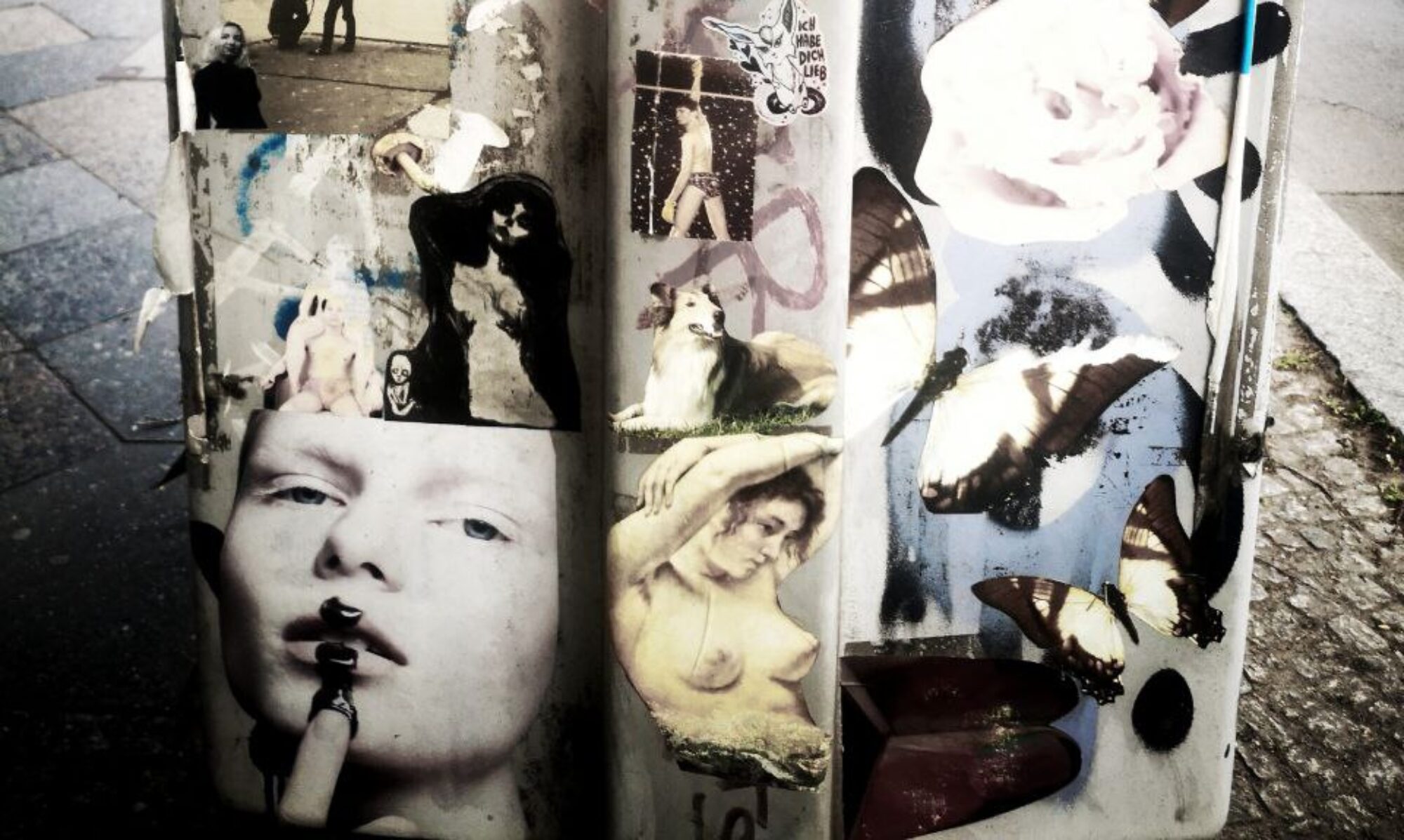Lars Holdgate
Zur Darstellung der Homosexualität in der Ostberliner Jugendzeitschrift ‘neues leben’, Jahrgang 1984
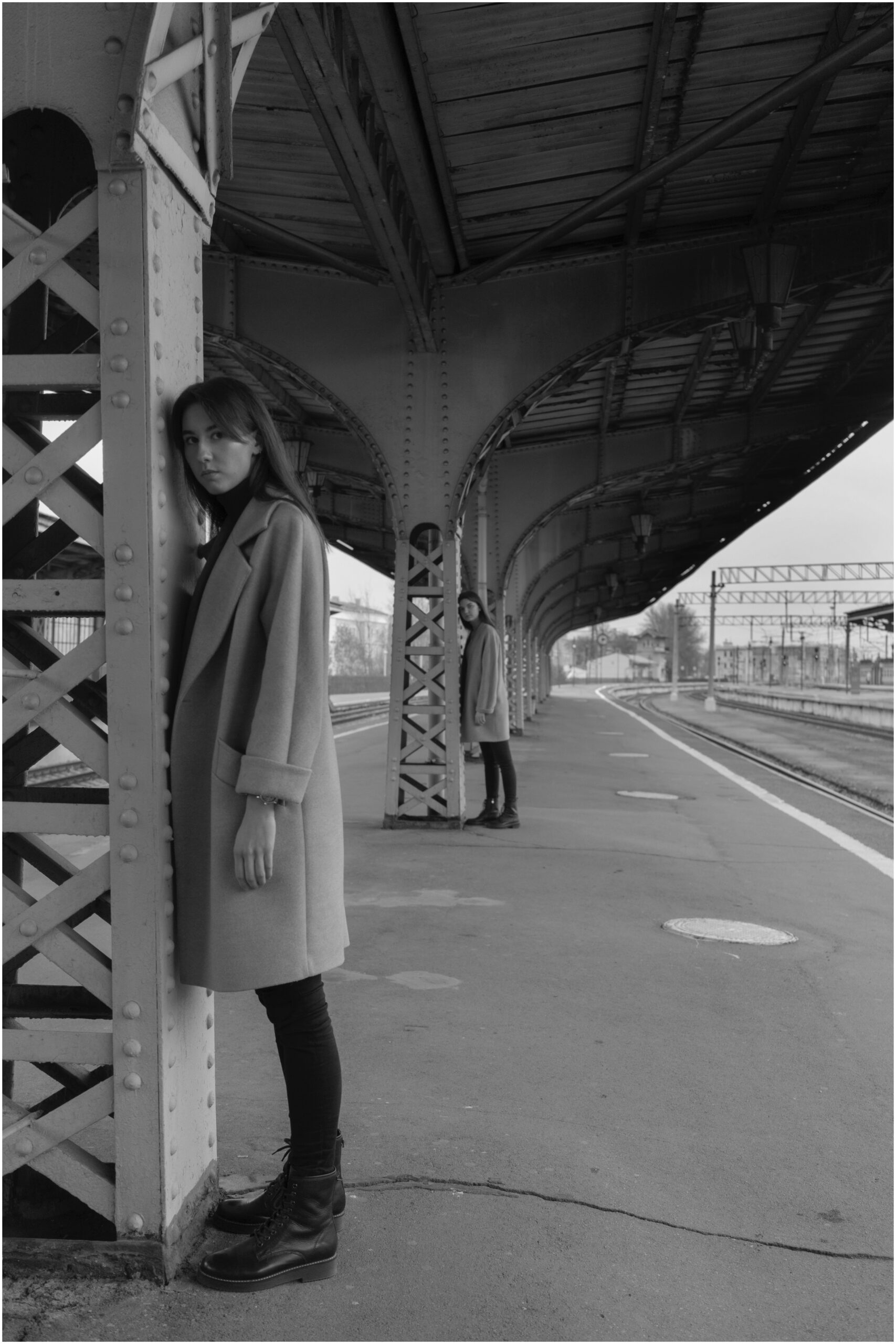
Forschungsthese
Ich gehe der Frage nach, ob die Darstellungsweise der Sexualität in der DDR-Jugendzeitschrift ‘neues leben’ mit dem staatlich propagierten Bild der Sexualität[1] und Beziehungsformen übereinstimmt. Kurz gefasst: Was war der Diskurs um die Sexualität und in welchem Verhältnis stand diese zu dem sozialen, ökonomischen und kulturellen Leben in der DDR?
Ich konzentriere ich mich auf die Jugendzeitschrift ‘neues leben’. Die Jugend war für die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) ein wichtiger Bestandteil ihres politischen Projektes. Der Erfolg des Sozialismus wurde als abhängig von der Sozialisierung der neuen Generation angesehen. Musik, Medien, Sport, Schule, Lehre und Freizeit sollten zur Aufrechterhaltung und Verbreitung von sozialistischen Werten beitragen. Diese dezidiert sozialistischen Institutionen waren auch Formen der Abgrenzung vom westlichen, kapitalistischen System. Die Sexualerziehung war ein wichtiger Bereich der staatlichen Jugendpolitik und diente auch zur Herausbildung einer eigenen, sozialistischen Identität.
Wie die Historikerin Dagmar Herzog für die deutsche Geschichte herausgearbeitet hat, ist die Sexualität ein wichtiges Feld politischer Auseinandersetzung (Herzog 2005). In besonderem Maße zeigt sich für Herzog am Beispiel der Sexualpolitik der DDR, dass die Sexualität “ein besonders dichter Durchgangspunkt für Machtbeziehungen” (Foucault, 1983, S. 125) ist. Die Sexualität war in der DDR also von politischem Interesse: mittels der Sexualpolitik sollte das Verhältnis von Staat und Bevölkerung ausgestaltet werden. Auch nach außen fungierte die Etablierung einer sozialistischen Sexualkultur als Abgrenzung vom Westen, insbesondere von Westdeutschland. Prostitution und Pornografie wurden als rein kapitalistische Erscheinungsformen angesehen, als ‘Schmutz’ des Westens, den es in sozialistischen Ländern nicht gebe. Dabei bezog sich der Diskurs auch auf Geschlechterfragen und sozio-ökonomische Verhältnisse zwischen Männern und Frauen. Die ‘Emanzipation der Frau’ im Sozialismus, insbesondere ihre ökonomische Unabhängigkeit, bedinge nicht nur die Abwesenheit von Prostitution, sondern auch die Entfaltung tiefer Liebesbeziehungen, die nicht – wie im Westen – einem ‘Warencharakter’ anheim fielen.
Herzog argumentiert, dass in der DDR gerade die Bedingungen für die Möglichkeit ‘guter Liebe’ herrschten. In den ozialen Strukturen, die eine finanzielle Unabhängigkeit für Frauen gewährleisteten, sieht sie die Grundlage einer persönlichen und sexuellen Freiheit der Frau. Unglückliche Ehen mussten nicht aufgrund von finanzieller Absicherung der Frau weitergeführt werden, so Herzog (Herzog 2005).
Reflexion und Arbeit mit historischen Quellen
Vorab muss anerkannt werden, dass eine Analyse von historischen Artefakten, wie dieser Zeitschrift, nie gänzlich objektiv erfolgen kann und einer Reflexion der eigenen Position als Forscher:in bedarf. Meine eigenen gelebten und erlebten Erfahrungen als westlicher, heterosexueller, weißer cis-Mann haben einen Einfluss auf meine Wahrnehmung und wissenschaftlichen Analysen. Daher ziehe ich Sekundärliteratur und Briefe der Leser:innenschaft, die in den Zeitschriften enthalten sind, zur Kontextualisierung hinzu. So ist es möglich auch zeithistorische Perspektiven von ostdeutschen Jugendlichen in meine Analyse mit einzubeziehen. In der Analyse des Materials interessieren mich besonders folgende Fragen: Was war ein dominanter Diskurs zur Sexualität in der DDR? Was wurde als Idealbild verbreitet? Was sollten Jugendliche unter Sexualität verstehen? Dabei bietet sich das Format der Zeitschrift insbesondere dadurch an, dass es staatliche Vorstellungen zur Sexualität an die Zielgruppe der Jugendlichen verbreiten sollte. Aufgrund der strengen Zensur der DDR fand die Ebene staatlicher Sexualpolitik eingang in die Publikationen.
[1] Aufgrund der Zensurmaßnahmen ist das gesellschaftlich vorherrschende Bild von dem staatlich propagierten Konzept von Sexualität nicht klar zu trennen.
Die illustrierte Jugendzeitschrift ‘neues leben’ erschien zwischen den Jahren 1954—1992 und wurde vom Zentralrat der FDJ herausgegeben. Ihre Zielgruppe waren Jugendliche im Alter von 13—26 Jahren. Der Verlag ‘junge welt’ hatte seinen Sitz in Berlin. Mit einem Preis von 80 Pfennig war die Zeitschrift vergleichsweise günstig zu erstehen, allerdings wegen ihrer Beliebtheit nicht immer leicht erhältlich.[1] Zusätzlich hatte der in der DDR existierende Papiermangel die Folge, dass die Auflagenhöhe auf ca. 500.000 begrenzt wurde.[2] In ihren 38 Erscheinungsjahren variierte die Zeitschrift in ihren Themen, Inhalten und Darstellungen. Ihre Entwicklung war gewissermaßen an die sozio-politische Lage der DDR gebunden.
[1] http://ddr-comics.de/nl.htm
[2] http://www.madeingdr.de/gdrsite/zeitungen/index2_(2).htm
Format
Die Themen Sex und Sexualität waren nicht die zentralen Motive der Zeitschrift. ‘neues leben’ war eine Jugendzeitschrift, in der die Sexualität im Rahmen der Jugend bzw. als Thema, das die Jugend betrifft, behandelt wurde. Sexualität wurde bildlich dargestellt, in Form von Aktbildern und Aktpostern, die zwar selten erschienen, allerdings unter der Leser:innenschaft sehr beliebt waren. In erster Linie erschien die Sexualität als Thema im Rahmen der Sexualufklärung. Dies, hauptsächlich aber nicht ausschließlich, durch den Sexualwissenschaftler Prof. Dr. Rolf Borrmann in der Reihe ‘Professor Dr. Borrmann antwortet’.
Das Format besteht aus einem Brief von eine:r Leser:in, in der ein persönliches Problem, das zum Themengebiet Liebe, Beziehungen, Freundschaft und Sexualität gehört, geschildert wird. Zu dieser Fragestellung äußert sich Prof. Dr. Borrmann in Form einer persönlichen Antwort. Die angesprochenen Themen und Probleme weisen überwiegend auf einen Informationswunsch der Jugendlichen hin, die über sexuelle Themen aufgeklärt werden wollen. Die Antworten von Prof. Dr. Borrmann sind so formuliert, dass möglichst viele verschiedene Situationen und Szenarien abgedeckt werden und demzufolge möglichst vielen Leser:innen ein Informations- und Problemlösungsangebot gemacht werden kann.
Übersicht: 1984
Das Sexualaufklärungsbeispiel, auf das ich mich in meiner Arbeit konzentriere, stammt aus dem Jahr 1984. Obwohl ich mich nur auf diesen Austausch beziehe, habe ich in meiner Recherche Beispiele aus den Jahrgängen 1982, 1983, 1984, 1985 und 1986 beachtet.
Die Themen, die von Prof. Dr. Borrmann in dem Jahr 1984[1] behandelt wurden, habe ich folgendermaßen kategorisiert:
| Thema/Anliegen | Anzahl |
| Streit mit Eltern wegen Partner | 1 |
| Angezogen zum selben Geschlecht | 1 |
| Generelle Beziehungsprobleme | 3 |
| Unerwiderte Liebe | 2 |
| Geschlechtsverkehr und Masturbation | 3 |
| Selbstwertgefühl/Attraktivität | 1 |
Diese Übersicht zeigt, dass vor allem Fragen zu zwischenmenschlichen Beziehungen und Geschlechtsverkehr öfters erschienen und somit einen gewissen Stellenwert trugen. Ob dies das Interesse der Leserschaft oder die Entscheidungen der Redaktion widerspiegelt ist für meine Analyse erstmal nicht wichtig, bleibt aber trotzdem eine wichtige Frage, die später aufgegriffen wird.
Ausgabe 2/84, S.56, 57: Homsexualität (1984)

Frage
Karin L. (17) und Sigrid P. (18) sind zwei Freundinnen mit einem “große[n] Problem”: Seit drei Monaten fühlen sie eine gegenseitige Anziehung. Zwischen den beiden kommt es auch zu intimen Momenten, unter anderem küssen sie sich. Eine Abneigung oder Angst vor dem männlichen Geschlecht soll es auch geben: “Immer wenn wir einen Jungen sehen fassen wir uns an und gehen schnell weg”. Weil andere Leute sich über sie lustig machen, schämen sie sich. Die Eltern wollen, dass die Freundschaft abgebrochen wird. Karin und Sigrid haben das Gefühl sie seien lesbisch und wissen nicht was sie machen sollen.
Antwort
Professor Dr. Borrmann beginnt seine Antwort mit dem Hinweis, dass auf sozialer Ebene Homosexualität bei Männern viel negativer wahrgenommen wird, als bei Frauen. Hiermit möchte Borrmann betonen, dass das Wissen über die Ursachen und Erscheinungsformen der Homosexualität in der Gesellschaft gering ausgeprägt ist. In seinen eigenen Worten:
“Es ist immer noch nicht ins allgemeine Verständnis gedrungen, dass diese vom Sexualleben der Masse abweichende Form keine Perversion ist, durch die irgendein anderer Mensch gefährdet ist. Homosexualität ist dem Manne oder der Frau gleichermaßen — ich bin versucht zu schreiben schicksalhaft — gegeben.” S. 57
Borrmann trennt körperliche Anziehung und Liebe. Diese Trennung hat eine ausschlaggebende Auswirkung auf das was in diesem Rahmen als ‘Sexualität’ konzipiert wird. Borrmann differenziert zwischen ‘echter’ Homosexualität (bzw. “lesbische[r] Liebe”) und vorübergehenden homosexuellen Gefühlen. Für ihn ist der “Ausdruck echter Homosexualität” ein:e gleichgeschlechtliche:r Partner:in. Bormann bespricht auch die Wandelbarkeit der Sexualität und erklärt, dass “[d]as endgültige Sexualverhalten […] sich erst zwischen 20 und 25 heraus [bildet]”.“Früheres Schwanken beim Hingezogensein zum anderen oder zum eigenen Geschlecht berechtigt lediglich zu der Feststellung, dass eine klare Festlegung des Sexualziels noch nicht erfolgt ist.” Für Borrmann heißt es also, dass die geschilderten Gegebenheiten kein Grund seien zu denken, dass Karin und Sigrid homosexuell sind. Zum Schluss bespricht Borrmann die Möglichkeit, dass eine oder sogar beide der Jugendlichen nicht homosexuell sind und einfach nur noch nicht den richtigen Mann gefunden haben, für den sie ihre Freundin dann verlassen würden. Die Funktion jeglicher ärztlichen Behandlung, um die Homosexualität zu ‘korrigieren’ wird vom Sexualaufklärer jedoch ausgeschlossen.
Antworten an Karin und Sigrid: Briefe der Leserschaft aus ‘nl direkt’ in der Ausgabe 3/84
In der darauffolgenden Ausgabe von ‘neues leben’ (3/84) reagieren Leser:innen auf den Brief von Karin und Sigrid und die Antwort Borrmanns. Reaktionen der Leser:innen sehen die Frage der Homosexualität ähnlich wie Prof. Dr. Borrmann. Janina aus Berlin sieht die mögliche Homosexualität zwischen den beiden als unproblematisch und eine gute Freundschaft wie die, die beschrieben wurde, als erstrebsam. Hingegen sehen zwei andere Leser:innen keine direkte Verbindung zwischen dem Küssen und einer möglichen Homosexualität. Martina aus Rostock glaubt, dass der richtige Partner zur Auflösung dieser intimen Freundschaft führen wird, genau wie es bei ihr auch der Fall war.
Analyse
In erster Linie wird zum Ausdruck gebracht, dass Homosexualität sowohl von Karin und Sigrid als auch von ihrem sozialen Umfeld als negativ bewertet wird. Die Tatsache, dass Menschen sich über sie lustig machen und ihre Eltern eine Beziehung verbieten, deuten darauf hin, dass sie Homophobie in ihrem direkten Umfeld als ‘normal’ erlebt haben. Gleichzeitig verteidigt Borrmann die Homosexualität und betont, dass sie “keine[n] Makel oder [eine E]entgleisung” darstellt. Obwohl Borrmann Homosexualität als natürliches Phänomen beschreibt und jegliche psychisch und physisch pathologisierende Zuschreibungen verneint, beinhaltet seine Antwort eine latente Abwertung der Homosexualität. Die Aussage, dass das Sexualziel noch nicht festgelegt wurde und homosexuelle Gefühle verschwinden würden, sobald man ‘den richtigen Mann findet’, scheint Homosexualität in gewisser Hinsicht abzulehnen. Es gäbe keinen Grund zu vermuten, dass Karin und Sigrid lesbisch sind, was im Kontrast zu ihrer eigenen Einschätzung der Situation steht.
Die Frage ‘Wann weiß man, ob man homosexuell ist?’ ist also ein zentraler Aspekt der Diskussion. Borrmanns Antwort deutet auf die Wichtigkeit der Partnerin oder des Partners in der Entdeckung und Entwicklung der eigenen Geschlechtsidentität hin. Dabei bezieht er sich auf zwei Ebenen zwischenmenschlicher Beziehungen: die sog. ‘intime Beziehung’ (den Sexualakt) und die Liebesbeziehung, als emotional-romantisches Verhältnis. Die sexuelle Orientierung ergibt sich für ihn aus der Verbindung beider Ebenen. Damit werden Sexualität und Identität an den Topos der Liebe gebunden. Für Bormann scheint die Herausbildung einer hetero- oder homosexuellen Orientierung in paradoxer Weise einer romantischen Partnerschaft vor- und nachgelagert zu sein: Homosexualität ist nicht ‘korrigierbar’, also nicht sozial veränderbar, gleichzeitig jedoch ‘verwechselbar’, wenn gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen als homosexuell ‘missgedeutet’ werden. Als relevante Kategorie der Bestimmung sexueller Orientierung setzt er die langfristige Partnerschaft. Diese Aufwertung der Partnerschaft und Abwertung flüchtiger Beziehungen weist einen sozialistischen Grundgedanken auf: Die Gemeinschaft ist ein wichtiges Gut und wird durch Egoismus gefährdet. Dies ist ein Motiv, das bei Prof. Dr. Borrmann Antwortet öfter vorkommt. Z.B. In der Ausgabe 9/84 erhält eine Leserin Aufklärung über die Masturbation. Auch hier werden auf Liebe basierende Partnerschaftsbeziehungen über das Ausleben einer sexuellen Lust (in diesem Fall das Erreichen eines Orgasmus), gestellt. Sozio-politische bzw. ökonomische Diskurse können in dem propagierten Bild des Sexuallebens erkannt werden. Eine sozialistische Sozialisierung dringt auch in das Sexualleben ein. Natürlich waren Partnerschaftsbeziehungen kein Unikat der DDR oder der anderen sozialistischen Länder. Nichtsdestotrotz ist es schwer den Diskurs, der kollektives Verhalten befürwortet und individuelles ablehnt, in einer Gesellschaft, die auf Kollektivismus basierte, zu ignorieren. Borrmann beendet seine Antwort mit: “Ich kann Ihnen abschließend nur wünschen, mögen Sie nun hetero- oder homosexuell sein, daß Sie ein dauerhaftes Glück in einer engen Partnerschaft finden, die Ihr leben bereichert […]”. Die Sexualität ist egal, die Beziehungsform aber nicht. Darüber hinaus beinhaltet dieser Satz eine subtile Verflechtung von Sexualität und Politik, welche im Rahmen der DDR auch von Josie Mclellan erkannt wird: “Sexuality (as opposed to the sexual act) involves the private world of bodies and emotions and the public world of politics, economics, and social policy” (2011, S. 13, 14).
Kontextualisierung
Der Paragraph 175, der homosexuelle Beziehungen unter Strafe stellte, wurde nach dem zweiten Weltkrieg in beiden deutschen Staaten von der NS-Diktatur übernommen (Eder 2009). In der DDR wurde dieser im Juni 1968 durch den Paragraphen 151 ersetzt, welcher homosexuellen Kontakt unter Volljährigen nicht mehr kriminalisierte, sondern nur noch Kontakte mit Minderjährigen (dies galt folgend auch für Frauen). Trotz dieser neuen juristischen Grundlage, die im Vergleich zur BRD eine gewisse Progressivität aufwies, wurden homosexuelle Menschen, vor allem schwule Männer, weiterhin gesellschaftlich ausgegrenzt.
Diese gesellschaftliche Abneigung erfolgte auch durch eine Einschränkung der öffentlichen Sichtbarkeit und Repräsentation der Homosexualität. Die SED soll eine niedrigere Zahl von Homosexuellen publiziert haben, als es eigentlich gab. Ziel dieser getäuschten Angaben war, Jugendliche von der Homosexualität fern zu halten, trotz der offiziellen Toleranz gleichgeschlechticher Liebe (Herzog, 2008, S. 77). Dieses Paradox ist in ‚neues Leben‘ auch erkenntlich: Einerseits wird die Homosexualität nicht als negativ bewertet, andererseits subtil abgewertet.
Sprache der Aufklärung: Was ist Sexualität?
Es besteht die Frage: Was für ein Bild der Sexualität bzw. des Sexualverhaltens wurde in der Jugendzeitschrift ‘neues leben’ 1984 dargestellt? Die Frage lässt sich nicht leicht beantworten, denn es gibt keine explizite Antwort. In der DDR war der Diskurs rund um die Sexualität ein Diskurs der Liebe. Josie Mclellan beschreibt es folgendermaßen: “sex was about love, not money” (2011, S. 174). Partnerschaften und Beziehungen machen allerdings auch einen wichtigen Bestandteil dieser Definition aus. Liebe sollte konstitutiverTeil der Sexualität sein.

Sexualität ist etwas, was mit anderen Menschen ausgelebt wird. Andere Menschen beeinflussen das eigene Sexualverhalten. Sexualität ist also sozial. Gleichzeitig ist die ‘ideale’ Sexualität eine sozialistische. Es ist wiederum der Diskurs der Liebe, der in Verbindung mit der Frage nach der idealen Beziehungsform eingesetzt wurde, um als Abgrenzung zum Westen zu dienen. Auch wenn dieser Bezug zum Westen in Prof. Dr. Borrmanns Antwort nicht explizit angesprochen wird, entspricht er einem dominanten Diskurs der Zeit.
Darstellungsweise: Wie geraten wir mit der Sexualität in Kontakt?
Die zuvor erwähnte Beliebtheit des Magazins ist auch wichtig, um die Verbreitung und den Einfluss der beinhalteten Ideen zu kontextualisieren. Leider lässt sich diese Vermutung nicht nachweisen, doch man kann damit rechnen, dass der Rat von Prof. Dr. Borrmann bis zu 500.000 Leser:innen hat erreichen können. Es heißt also, dass man nicht nur von einem gewissen Bild der Sexualität bzw. Sexualverhaltens spricht, sondern, dass dieses Bild auch gleichzeitig zum Bestandteil einer sozialen Realität wurde. Auch wenn dieses Bild nicht die Perspektiven aller Leser:innen repräsentierte[2] oder beeinflusste, ist es trotzdem als produktiv einzuschätzen, im Sinne davon, dass es einen wichtigen Zugang zum Thema des Sexualverhaltens gab und Individuen sich im Verhältnis zu diesem Bild positionierten und ihre Meinungen entwickelten. Der Einfluss der Zeitschrift darf allerdings nicht in Isolation gesehen werden: Andere Zugänge zur Sexualität existierten auch: ob eigene persönliche Erfahrungen, andere Formen der Sexualaufklärung, Erfahrungen anderer, usw.. Die Darstellung der Sexualität in der Zeitschrift ‘neues leben’ gilt also nicht als verallgemeinerte gesellschaftliche Perspektive. Nichtsdestotrotz bedeutet die Tatsache, dass diese Perspektive in einer DDR-Jugendzeitschrift gedruckt werden konnte, in einem Staat der anhand strenger Zensurmaßnahmen ein gewisses Bild von sich auf internationaler Ebene sowohl als auch gegenüber seinen Bürger:innen schaffen wollte, dass dieses Bild eins ist, das der Staat propagieren wollte. Herzog kommentiert, dass ein solches Bild für die DDR besonders wichtig war und die SED es aktiv propagierte, weil sie nicht als puritanisch gesehen werden wollte (Herzog 2008). Das Beispiel von Prof. Dr. Borrmann belegt in vielen Hinsichten Zimmermann’s Erkenntnis, dass die Sexualerziehung in der DDR sehr eng mit dem Sozialismus verbunden war (Zimmermann 1999).
[1] Die Ausgabe 11/84 war für mich nicht erhältlich, also ist diese nicht in meiner Analyse mit einbezogen
[2] In dem Segment ‘nldirekt’ werden Briefe der Leser:innen gedruckt. Oftmals äußeren Leser:innen Kritik an Prof. Dr. Borrmann oder der fragenden Person. Eine Vielfalt an Perspektiven existiert also trotzdem.